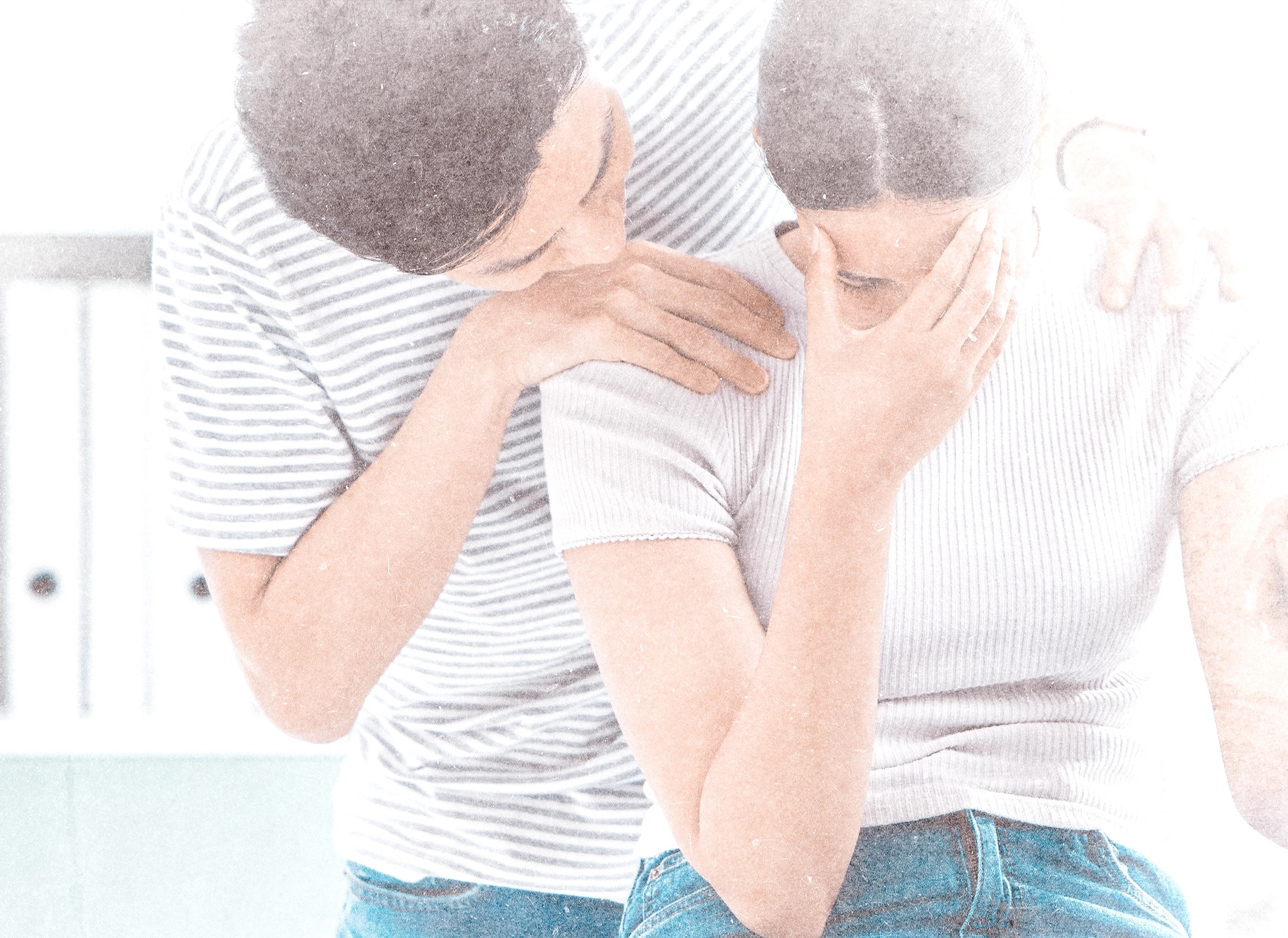Stell dir vor, du würdest dir das Bein brechen – und es nicht einmal bemerken. Kein Schmerz, keine Warnung, nichts. Genau das passiert der Marsili-Familie, über die wir im letzten Blog gesprochen haben. (LINK) Diese italienische Familie besitzt eine seltene Genmutation, die ihr Schmerzempfinden stark reduziert.
Doch während die Marsilis zu wenig Schmerz empfinden, gibt es das Gegenteil: Menschen, bei denen Schmerz nicht mehr verschwindet. Was passiert, wenn der Körper den Schmerz nicht mehr loslässt? Und warum kann er sich verselbstständigen?
Was bedeutet „chronischer Schmerz“?
Das Wort „chronisch“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „zur Zeit gehörend“. In der Medizin beschreibt es Symptome, die über mindestens drei bis sechs Monate bestehen.
Doch chronisch bedeutet nicht automatisch „für immer“. Chronische Schmerzen unterscheiden sich von akuten Schmerzen:
- Akuter Schmerz ist eine direkte Reaktion auf eine Verletzung und klingt nach der Heilung ab.
- Chronischer Schmerz bleibt bestehen – selbst wenn keine klare Ursache mehr erkennbar ist.
Der Grund: Das Nervensystem befindet sich in einem dauerhaften Alarmzustand. Das Gehirn und das Rückenmark reagieren überempfindlich auf Reize – selbst harmlose Signale können als schmerzhaft wahrgenommen werden.
Die AWMF-Leitlinie beschreibt chronischen Schmerz als eigenständige Erkrankung (Schmerzsyndrom). Er entsteht durch ein komplexes Zusammenspiel von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren. Deshalb spricht man heute zunehmend von anhaltenden oder persistierenden Schmerzen, um deutlich zu machen, dass Schmerzen dynamisch und beeinflussbar sind – und kein unveränderbares Schicksal darstellen (AWMF, 2025). Link
Warum Schmerz mehr ist als eine Warnung
Schmerz ist mehr als eine rein körperliche Empfindung. Das Bio-Psycho-Soziale Modell zeigt, dass drei Faktoren zusammenspielen (Deutsche Schmerzgesellschaft, 2022) (Link):
- Biologisch: Verletzungen, Entzündungen, Nervenschädigungen, genetische Veranlagungen
- Psychologisch: Stress, Ängste, Depressionen, belastende Denkmuster
- Sozial: Arbeitsdruck, Isolation, Konflikte, finanzielle Unsicherheit
Jeder dieser Bereiche kann Schmerz verstärken oder lindern. Beispiel: Stress reduziert die Wirksamkeit körpereigener Schmerzhemmungssysteme. Umgekehrt wirkt soziale Unterstützung oft schmerzlindernd.
Vielleicht hast du selbst schon bemerkt, dass deine Schmerzen in stressigen Zeiten stärker sind – und an guten Tagen schwächer. Das ist keine Einbildung, sondern Ausdruck dieses Zusammenspiels.
Warum Schmerztherapie oft an ihre Grenzen stößt
In der Praxis ist die Idee des biopsychosozialen Therapie oft schwer umzusetzen:
- Medikamente im Fokus: Oft werden nur Symptome behandelt.
- Zu wenig interdisziplinär: Physiotherapie, Psychotherapie, Medikamente und soziale Unterstützung greifen selten verzahnt ineinander.
- Zeit & Geld: Viele Patient:innen haben nicht die Ressourcen, um ganzheitliche Ansätze regelmäßig wahrzunehmen.
- Gesellschaftlicher Druck: Schmerz gilt häufig als Schwäche. Viele „funktionieren“ weiter, statt eine umfassende Behandlung zu suchen.
Das Problem ist also nicht nur der Schmerz – sondern ein Gesundheitssystem, das der Komplexität von Schmerzerkrankungen kaum gerecht wird.
Umschulungskurs: Schmerzmanagement
Auch wenn die ideale Therapie schwer erreichbar ist, heißt das nicht, dass du nichts tun kannst. Schmerzmanagement bedeutet, den Schmerz in seiner ganzen Komplexität zu verstehen – und aktiv zu beeinflussen.
- Manche biologische Ursachen lassen sich nicht rückgängig machen, z. B. degenerierte Bandscheiben.
- Doch entscheidend ist, wie dein Nervensystem mit Reizen umgeht.
Die „Umschulung“ bedeutet:
- Du lernst, Faktoren zu erkennen, die deinen Schmerz verstärken oder lindern.
- Du entwickelst neue Strategien, wie du trotz Schmerz dein Leben gestaltest.
Beobachte einmal bewusst: Welche Rolle spielen Stress, Bewegung, soziale Kontakte oder Entspannung bei deinen Schmerzen? Diese Auseinandersetzung ist der erste Schritt zu mehr Kontrolle und Lebensqualität.
In einer persönlichen Online-Beratung erarbeiten wir gemeinsam Strategien für dein individuelles biopsychosoziales Schmerzmanagement.
👉 Jetzt Onlineberatung Schmerzmanagement starten
Die Matrix im Kopf: Wie das Gehirn Schmerz verändert
Das Konzept der kortikalen Körpermatrix beschreibt, wie das Gehirn Schmerz verarbeitet und dabei auch durch äußere Reize beeinflusst wird. In einem bekannten Experiment zeigten Moseley et al. (2008), (Link) dass der Schmerz bei Menschen mit Armschmerzen stärker empfunden wurde, wenn sie den betroffenen Arm durch eine Vergrößerungslinse sahen – und schwächer, wenn sie ihn durch eine Verkleinerungslinse betrachteten.
Das Gehirn interpretiert Größe und Bedrohung – und passt die Schmerzintensität an. Unsere Wahrnehmung beeinflusst also direkt, wie stark wir Schmerz empfinden.
Frage dich: Welche „Vergrößerungslinsen“ gibt es in deinem Leben – Faktoren, die Schmerz schlimmer machen? Und welche „Verkleinerungslinsen“ helfen dir, ihn zu reduzieren?
Schmerz unter der Vergrößerungslinse: Risikofaktoren
Diese Faktoren können das Nervensystem sensibilisieren und Schmerzen verstärken – ein Prozess, der in der Fachliteratur als zentrale Sensibilisierung beschrieben wird (Latremoliere & Woolf, 2009) (Link):
- Langanhaltende Entzündungen oder Nervenverletzungen
- Wiederholte Schmerzreize über längere Zeiträume
- Stress, der die Schmerzhemmung reduziert
- Überempfindlichkeit des Nervensystems (Hyperalgesie, Allodynie)
- Frühere Schmerz- oder Traumaerfahrungen, die die Reizverarbeitung verändern
Schmerz unter der Verkleinerungslinse: Schutzfaktoren
Glücklicherweise gibt es auch Faktoren, die Schmerzen abmildern und helfen können, sie besser zu bewältigen. Studien zeigen, dass kognitive und emotionale Prozesse die Schmerzwahrnehmung regulieren können (Bushnell et al., 2013):
- Positive Emotionen und eine stabile Stimmungslage
- Ablenkung und gezielte Aufmerksamkeit weg vom Schmerz
- Erwartung von Schmerzlinderung (Placebo-Effekte, Selbstwirksamkeit)
- Soziale Unterstützung und vertrauensvolle Beziehungen
- Strategien zur Emotionsregulation wie Meditation oder Atemübungen
Chronischer Schmerz: Kein Schicksal, sondern veränderbar
„Chronisch“ klingt nach etwas Endgültigem – fast wie ein Epos ohne Ende. Doch moderne Forschung zeigt: Schmerzen sind dynamisch.
- Schmerz ist nicht gleich Schaden: Nervenzellen können überempfindlich werden – auch ohne aktuelle Verletzung.
- Schmerz kann sich verselbstständigen: Das Nervensystem fällt in einen Dauer-Alarmzustand – ein anerkannter Zustand als eigenständige Erkrankung.
- Schmerz ist biopsychosozial: Biologie, Psyche und Umfeld spielen zusammen und formen das Erleben von Schmerz.
- Schmerz ist beeinflussbar: Er ist nicht nur von Nerven- oder Gewebeprozessen abhängig, sondern wird stark durch Emotionen, kognitive Verarbeitung und Stimmung beeinflusst (Bushnell et al., 2013) (https://www.nature.com/articles/nrn3516). Meditation, Yoga, Achtsamkeit und kognitive Strategien können tatsächlich das Schmerzerleben regulieren.
Chronischer Schmerz ist also kein unveränderbares Schicksal. Dein Nervensystem ist plastisch, veränderbar – und kann lernen, Schmerz anders wahrzunehmen.
FAQ: Noch mal kurz & knackig
Was unterscheidet akuten von chronischen Schmerz?
Akuter Schmerz klingt nach der Heilung ab. Chronischer Schmerz bleibt, auch ohne klare Ursache.
Warum kann chronischer Schmerz bestehen bleiben?
Weil sich das Nervensystem in einen dauerhaften Alarmmodus versetzt.
Welche Faktoren verstärken Schmerzen?
Stress, negative Gedanken, Traumata, Isolation oder beruflicher Druck.
Welche Faktoren lindern Schmerzen?
Soziale Unterstützung, Bewegung, Resilienz, positive Strategien und Akzeptanz.
Ist chronischer Schmerz ein Schicksal?
Nein. Schmerzen sind beeinflussbar – das Nervensystem ist anpassungsfähig.
Quellen
- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF): Leitlinie Chronischer Schmerz (Link)
- Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. (2022): Patienteninformation Chronische Schmerzen (Link)
- Moseley, G. L., Parsons, T. J., & Spence, C. (2008). Visual distortion of a limb modulates the pain and swelling evoked by movement. Current Biology, 18(22), R1047–R1048. Link
- Latremoliere, A., & Woolf, C. J. (2009). Central sensitization: a generator of pain hypersensitivity by central neural plasticity. The Journal of Pain, 10(9), 895-926. Link
- Bushnell, M. C., et al. (2013). Cognitive and emotional control of pain and its disruption in chronic pain. Nature Reviews Neuroscience, 14(7), 502-11. Link