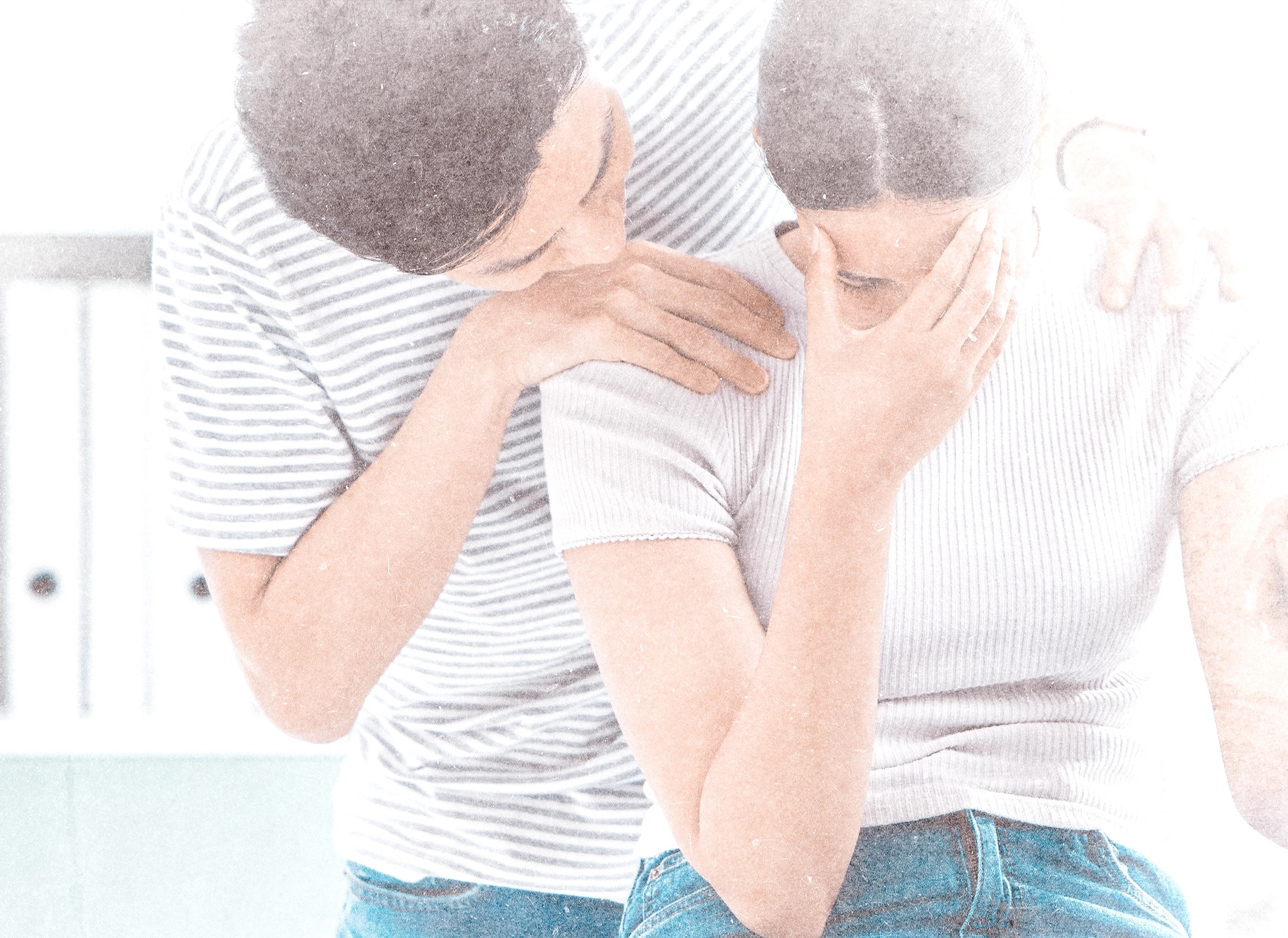Stell dir vor, du hebst eine Kiste – nicht besonders schwer, nur unhandlich. Plötzlich zieht ein brennender Schmerz in dein Bein. Genau das ist Uwe (Name von der Autorin verändert) passiert.
Am nächsten Morgen kann Uwe sich kaum bewegen. Zum Ärger seines Chefs meldet er sich krank. Die kühle Reaktion seines Arbeitgebers trifft ihn mehr, als er es zugeben will. Wäre er doch besser gleich nach Hause gegangen! Der Orthopäde, zu dem er sich schleppt, veranlasst ein MRT – allerdings erst in vier Wochen.
Aus Angst vor dem, was ihn an sozialen Druck erwartet, kehrt Uwe schon nach drei Tagen an den Arbeitsplatz zurück. Dabei weiß er genau, dass sein Rücken etwas anderes bräuchte. Doch was soll er tun? Zuhause warten ebenfalls Aufgaben: Einkäufe, Gartenarbeit, handwerkliche Arbeiten. Und im Betrieb will er sich keine abfälligen Kommentare anhören. Also beißt er die Zähne zusammen.
So beginnt ein Teufelskreis, der typisch für viele Menschen mit Rückenschmerzen ist: Sie funktionieren, obwohl der Körper längst ein Warnsignal sendet.
Vier Wochen später liegt endlich das MRT-Ergebnis vor: ein Schaden an der Bandscheibe, aber noch kein klassischer Bandscheibenvorfall. Uwe atmet erleichtert auf. Die Diagnose klingt weniger bedrohlich, als er befürchtet hatte. Doch die verordnete Physiotherapie startet erst drei Wochen später - die Praxis ist voll. In dieser Zwischenzeit informiert er sich im Internet. Dort liest er Sätze wie „Bandscheiben können platzen, wenn man sie zu sehr belastet.“ Das wirkt übertrieben, bleibt ihm aber im Kopf. Aus Angst belastet er seinen Rücken im Alltag so wenig wie möglich – außer bei der Arbeit, wo er keine Wahl sieht. Das mulmige Gefühl das er mit seiner Arbeit verbindet, wächst somit stetig.
Warum ist Uwe’s Schonung in der Freizeit ungünstig?
Weil anhaltendes Schonverhalten zu Muskelabbau, Verspannungen und Durchblutungsstörungen führt. Was kurzfristig entlastet, verstärkt langfristig die Rückenschmerzen.
Heute, ein Jahr später, ist die Situation ambivalent. Beim Arbeiten selbst spürt Uwe kaum noch Schmerzen – doch sobald er nach Feierabend oder am Wochenende zur Ruhe kommt, meldet sich der Schmerz zurück. Er beschreibt es als brennendes Ziehen von der Pobacke bis in den Fuß – ein typisches Muster bei Ischiasschmerzen oder Reizungen des Nervensystems. Egal, wie er liegt oder sitzt, der Schmerz bleibt präsent. Er hat sich verändert, ist gewandert. Das macht ihm Angst: Was, wenn die Schmerzen für immer bleiben? Was, wenn sie eines Tages auch bei der Arbeit zurückkommen?
Gleichzeitig kennt er auch gute Tage: Momente voller Bewegung, Ablenkung, Freude. Doch diese Hoffnung wird wieder gedämpft, als sein Vater stirbt. Nach diesem Verlust nehmen die Schmerzen erneut Fahrt auf. Stress, Trauer und seelische Belastungen haben seinen Schmerz verstärkt – ein klassisches Beispiel für den biopsychosozialen Einfluss auf chronische Schmerzen.
Zu wenig Hilfe
Die Physiotherapie war zwar hilfreich, aber unzureichend: sechs Termine à 15–20 Minuten, ein paar Übungen, etwas Massage. Danach war Schluss. Uwe wusste nicht, wie er selbstständig weitermachen sollte – also ließ er es bleiben.
Warum reicht eine kurze Standardtherapie bei Rückenschmerzen oft nicht aus?
Weil Rückenschmerzen nicht nur körperlich sind. Sie entstehen durch ein Zusammenspiel von körperlichen Belastungen, psychischen Faktoren (Stress, Ängste, negative Gedanken) und sozialen Aspekten (Arbeit, Familie, fehlende Unterstützung). Eine nachhaltige Therapie müsste alle drei Ebenen berücksichtigen – doch genau das passiert selten.
So funktioniert Uwe weiter. Er schont sich, passt sich an, spricht mit niemandem darüber – nicht mit seinem Arbeitgeber, nicht mit Kolleg:innen, nicht mit seiner Familie. Nach außen wirkt er stabil. Doch innerlich fühlt er sich ausgeliefert und hilflos.
Wenn Schmerz bleibt: Sensibilisierung des Nervensystems
Uwes Geschichte zeigt, was bei zentraler Sensibilisierung passiert: Das Nervensystem hat gelernt, harmlose Reize als Gefahr zu interpretieren.
- Früher war es nur Druck – heute meldet das Gehirn Schmerz.
- Die ursprüngliche Verletzung ist vermutlich verheilt – der Schmerz aber bleibt.
Warum spürt Uwe an Arbeitstagen weniger Schmerz als am Wochenende? Ablenkung, Bewegung und soziale Kontakte senken die Schmerzwahrnehmung. Ruhe, Grübeln und Angst dagegen verstärken sie – wie eine Lupe, die alles größer erscheinen lässt. Dazu habe ich im vorherigen Artikel “Leid auf Zeit” ausführlicher geschrieben.
Die Deutsche Schmerzgesellschaft bringt es auf den Punkt:
„Körperliche Schonung kann bei akuten Schmerzen hilfreich sein. Bei chronischen Schmerzen bringt Schonung mehr Schaden als Nutzen“ (Deutsche Schmerzgesellschaft, 2021). Link
Schmerzverstärker und Schmerzsenker
Schmerz ist nicht nur körperlich – er ist immer biopsychosozial. Das heißt: Körper, Psyche und Umfeld beeinflussen, wie stark er empfunden wird.
Bewegung
- Verstärker: Bewegungsmangel, Schonverhalten
- Senker: regelmäßige, angepasste Bewegung
Entspannung
- Verstärker: langes Sitzen oder Liegen in ungünstigen Positionen
- Senker: Meditation, Sauna, Atemübungen
Gedanken
- Verstärker: Katastrophisieren („Was, wenn das nie besser wird?“)
- Senker: Hoffnung, positive Erlebnisse, Ablenkung
Gefühle
- Verstärker: Angst, Wut, Hilflosigkeit
- Senker: Freude, soziale Bindungen, Achtsamkeit
Therapie
- Verstärker: lange Wartezeiten, unklare Diagnosen
- Senker: klare Therapieansätze, vertrauensvolle Therapeut:innen
Soziales Umfeld
- Verstärker: Konflikte, Isolation, Druck
- Senker: Unterstützung, offene Gespräche
Lebensstil
- Verstärker: schlechte Ernährung, wenig Flüssigkeit
- Senker: ausgewogene Ernährung, bewusstes Essverhalten
Achtsamkeit
- Verstärker: Bedürfnisse ignorieren
- Senker: Selbstfürsorge, Entlastung
Jeder Mensch hat individuelle Verstärker und Senker. Bewusstes Beobachten kann helfen, den eigenen Schmerz aktiv zu beeinflussen.
Nosce te ipsum – Erkenne dich selbst
Uwe merkt, dass sein Schmerz nicht nur körperlich ist. Stress, Verlust, Ängste – all das verstärkt seine Beschwerden. Er hat gelernt: Schmerz entsteht nicht nur durch Gewebe, sondern auch durch Gedanken und Gefühle. So wie es vielen ergeht beginnt Uwe’s Reise zur Selbstfürsorge und Lebensstiländerung erst später - in seinem Fall ein Jahr später. Und das ist ok.
Schmerz ist kein unveränderbares Schicksal. Mit Selbstfürsorge, Bewegung, psychischer Unterstützung und wertvollen sozialen Kontakten lässt sich der Kreislauf durchbrechen.
In einer persönlichen Online-Beratung analysieren wir deine individuelle Situation, erkennen Verstärker und Senker deiner Schmerzen und entwickeln Strategien für dein Schmerzmanagement. So lernst du, wie du den Schmerz beeinflussen kannst .
👉 Jetzt persönliche Online-Beratung Schmerzmanagement starten
FAQ: Noch mal kurz & knackig
Warum bleibt Schmerz manchmal, obwohl die Verletzung verheilt ist?
Weil das Nervensystem überempfindlich wird – man spricht von zentraler Sensibilisierung.
Warum hat Uwe an Arbeitstagen weniger Schmerzen?
Ablenkung, Bewegung und soziale Kontakte lenken das Nervensystem um – in Ruhe richtet es den Fokus stärker auf Schmerz.
Welche Faktoren verstärken Schmerzen?
Stress, Angst, Schonverhalten, Isolation und negative Gedanken.
Welche Faktoren lindern Schmerzen?
Bewegung, Entspannung, soziale Unterstützung, positive Gedanken und Selbstfürsorge.
Ist Schonung bei chronischem Schmerz sinnvoll?
Nein. Anhaltende Schonung verschlimmert Schmerzen – Bewegung und Aktivität sind wichtiger.
Quelle
Deutsche Schmerzgesellschaft (2021). Patienteninformation: Schmerzen verstehen; Akuter Schmerz – Chronischer Schmerz. Link